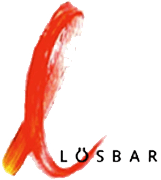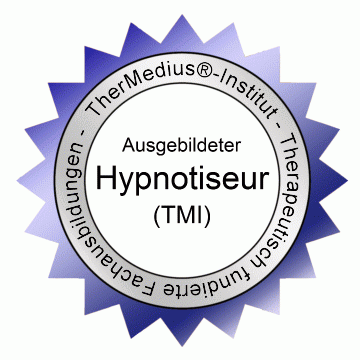Familien im Ausnahmezustand
Corona und die Folgen für Familien

Die Pandemie wirkt sich auf jeden aus - ganz besonders Familien wird durch die aktuelle Situation eine sehr belastende Mehrfachbelastung aufgebürdet.
Ganz gleich ob Kind, Jugendliche oder Erwachsene - das Wegbrechen des bekannten Lebens mit all seinen Sicherheit gebenden Systemen ist eine enorm verunsichernde Erfahrung. Hinzu kommen finanzieller Druck, Schwierigkeiten mit dem Homeschooling/ -learning, familiäre Konflikte, Beziehungsprobleme, Einsamkeit und die allgemeine Eintönigkeit durch geschlossene Geschäfte sowie Freizeitmöglichkeiten. Überdies ist natürlich eine Krise mit unbekanntem zeitlichen Ende ohnehin nicht leicht zu ertragen.
Die aktuelle Krisensituation wirkt zudem wie ein Brennglas für das Familiensystem: Unausgesprochenes verdichtet sich und wird zu wachsendem Konfliktpotential, bestehende Probleme rücken mangels Ablenkungen und Ausweichmöglichkeiten in das Zentrum.
Mehr Streitigkeiten, Krisen und emotionale Belastungen gehören zu den Folgen. In den warmen Monaten war dies einfacher zu kompensieren, da die Familienmitglieder das Zuhause verlassen und etwas unternehmen konnten. Es wurde Eis gegessen, geradelt oder gepicknickt. Oftmals zum ersten Mal seit langer Zeit. Es gab Phasen, in denen es mehr Zusammenhalt und Bindungsförderung als vor der Pandemie gab. Doch die beiden dunkleren und kälteren Jahreszeiten bieten kaum Möglichkeiten zur Abwechslung oder auch einfach nur die Möglichkeit, sich auch mal aus dem Weg gehen zu können.
Belastungen für Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche sind in besonderem Maße auf den Kontakt zu Gleichaltrigen ("Peer Groups") angewiesen, die für sie nicht nur Freundschaft, Unterhaltung, Spaß und Ausgleich bedeuteten, sondern auch zu den Wegweisern der eigenen Entwicklung gehören. Durch Gleichaltrige werden sie in ihrem Verhalten gespiegelt, probieren sich aus und definieren ihre Persönlichkeit in einem fortlaufenden Prozess. Sie suchen und finden einen Platz für sich in ihrem Sozialgefüge.
Werden sie von diesen Möglichkeiten getrennt und haben vielleicht zudem keine Geschwisterkinder, dann leiden sie besonders intensiv unter den Folgen.
Das Deutsche Jugendinstitut gab bereits im vergangenen Jahr eine Studie heraus, die aufzeigte, dass es Kinder mit regelmäßigem Kontakt zu Gleichaltrigen, Geschwistern, Großeltern und/oder Lehrpersonen psychisch deutlich besser ging als Kindern mit weniger Kontaktmöglichkeiten.
"Treffen schwierige Lebensverhältnisse, belastete Eltern und anspruchsvolle Kinder aufeinander, verstärken sich bereits vor der Pandemie bestehende Nachteile. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund des Kinderschutzes besorgniserregend. Deshalb ist es wichtig, Familien in dieser Zeit vermehrt Beratung anzubieten," so Studienleitern
Dr. Alexandra Langmeyer
(Quelle: Langmeyer/Guglhör_Rudan/Naab/Urlen/Winklhöfer 2020: Kind sein in Zeiten von Corona)
Einer aktuelle Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zufolge leidet inzwischen fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten.
"Unsere Ergebnisse zeigen erneut: Wer vor der Pandemie gut dastand, Strukturen erlernt hat und sich in seiner Familie wohl und gut aufgehoben fühlt, wird auch gut durch die Pandemie kommen", so Ulrike Ravens-Sieberer, Leiterin der Copsy-Studie und Forschungsdirektorin der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik des UKE. "Wir brauchen aber verlässlichere Konzepte, um insbesondere Kinder aus Risikofamilien zu unterstützen und ihre seelische Gesundheit zu stärken."
(Quelle: Copsy-Studie: https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/copsy-studie.html)
Die von der Studienleiterin erwähnten Strukturen stärken natürlich die Resilienz der Kinder, aber sie sind kein Zufall, sondern gehören zu den Leistungen der Eltern. Wer morgens bereits seine Kinder in die Alltagskleidung scheucht, sie dann beschult, ihnen ein offenes Ohr schenkt und anschließend noch für Ausgleich durch Beschäftigung sorgt, der bringt dafür eine Menge Energie auf ...
Belastungen für Eltern
Eltern stehen vor unglaublichen Herausforderungen und werden zugleich in ihrer Leistung oftmals übersehen oder ihre Klagen werden - vor allem in den sozialen Medien - oftmals abgetan mit Kommentaren wie:
"Ja, man muss sich eben um seine Kinder kümmern - hätteste dir echt mal früher überlegen sollen!"
Unter den Eltern stehen wiederum die Gruppen der Alleinerziehenden sowie die Familien mit drei und mehr Kindern vor besonders starken Belastungen. Sie müssen nicht nur einen Spagat zwischen Beruf und Familie schaffen, sondern einen Haushalt führen, die Kinder unterrichten (oder schlichtweg Unmengen an Hausaufgaben mit teils unmotivierten Kindern abarbeiten) und für die nötige emotionale und eben auch die finanzielle Sicherheit sorgen. Und das dann entweder überwiegend alleine oder eben bei vielen Kindern. Und dabei bleibt dann kaum noch Zeit für die eigene Erholung.
Im Grunde ist es unerlässlich, dass die Eltern als Team zusammenarbeiten. Leider - und das wissen wir alle - ist das oftmals nicht möglich. Selbst bei zusammen lebenden Paaren. Es liegen ältere und unaufgeräumte Konflikte oder auch belastende "Dauer-Themen" vor, die eine konstruktive Zusammenarbeit erschweren oder vielleicht sogar unmöglich machen. In der beengten Situation verstärken sich diese häufig und stehen einer Zusammenarbeit im Weg.
Hinzu kommen individuelle Belastungen wie eventuelle Erkrankungen (psychisch/physisch), Pflege von Angehörigen, Behinderungen oder andere Schwierigkeiten, die schon vor der Pandemie bestanden.
Und natürlich haben auch Eltern weniger Kontakt zu Freund*innen, Bekannten, Kolleg*innen und Nachbar*innen. Diese Kontaktarmut belastet natürlich nicht nur Kinder, sondern eben auch Erwachsene.
Während viele zu Beginn der Krise im vergangenen Jahr 2020 voller Tatendrang neue Sprachen lernten, bastelten und ihren Wohnraum renovierten, ist inzwischen bei vielen Menschen einfach "die Luft raus" - es fehlt an Energie und vor allem fehlt der Ausblick auf einen möglichen Zeitpunkt, an dem diese Situation endlich vorbei sein wird. Einen solchen Ausblick brauchen wir aber, damit wir durchhalten können und vor allem wissen, wie wir mit unseren Kräften am besten haushalten sollen.
Die Folgen
Menschen in dysfunktionalen Beziehungen erleben vielfach eine Zunahme der Konfliktsituationen und zusammen mit der räumliche Enge steigt hier oftmals die Gefahr der häuslichen Gewalt.
Deutschland hat ohnehin ein recht hohes Niveau an gewalttätigen Beziehungen und dieses ist durch die Pandemie weiter angestiegen. Von verschiedenen Arten der Gewalt betroffen sind nach wie vor mehrheitlich Frauen (81% weibliche / 19 % männliche Gewaltopfer) sowie auch Kinder. Die Situation aus Abhängigkeit, Angst und fehlenden Hilfemöglichkeiten ist in diesen Fällen gefährlich und natürlich massiv belastend.
Einen Anstieg gibt es auch bei den Fällen psychischer Probleme in nahezu allen Altersklassen. Depressionen und Ängste treten vermehrt auf. Viele Menschen haben mit psychosomatischen Symptomen zu kämpfen. Ganz besonders Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verspannungen. und Verdauungsstörungen zeigen sich als belastende Folgen des Stresses.
Betroffen sind viele Menschen auch von Erschöpfungssitutationen bis hin zum Burnout. Sie benötigen eine therapeutische Unterstützung.
Was tun?
Es gibt natürlich keine perfekte Lösung, die für jede Familie greift. Dazu sind Familiensysteme zu vielfältig.
Was Sie tun könnten:
- Kontakt und Austausch: Sprechen Sie mit Menschen in ähnlichen Situationen und finden Sie dadurch Entlastung. Manchmal ergeben sich hilfreiche Ideen und Tipps.
- Kreativität in der Alltagsgestaltung: Es klingt vielleicht trivial, aber kreativ und flexibel zu bleiben ist sehr wichtig. Wenn man sich schnell auf etwas Neues einstellt und sich von neuen Seiten kennenlernt, findet man immer einmal wieder neue Ressourcen.
- Das Positive sehen, auch wenn es winzig erscheint: Ja, manchmal klingt dieser Tipp eher provokant - wenn alles so richtig verfahren ist und man sich tief in einer Krise wiederfindet. Und doch sind da oftmals Anteile, die bereichern oder beibehalten werden wollen. Manchmal sind es Kleinigkeiten: Ein netter Gruß in der Post, ein alberner Moment mit den Kindern oder ein schönes Abendessen zuhause mit dem*r Partner*in.
- Aussprechen von Schwierigkeiten: Gegenüber Lehrpersonen oder anderen Menschen, mit denen wir etwas verändern können und möchten: Ansprechen. Oft lassen sich Lösungen finden, die wenigstens ein bisschen Erleichterung verschaffen.
- Sie müssen auch für Ihre Kinder kein Übermensch sein - legen Sie sich mit dem Nachwuchs mal auf das Sofa und schauen einen Film, kochen Sie simpel, lassen Sie 5 gerade sein. Perfektionismus ist derzeit vollkommen unnötig. Dies erfüllt neben der eigenen Entspannung noch den Zweck der Vorbildfunktion für die Kinder: "Niemand muss perfekt sein, jeder darf mal erschöpft sein und: es gibt immer irgendeine Lösung."
- Priorisieren: Es ist ungemein entlastend, wenn man sehr genau schaut, welche Aufgabe zu welchem Zeitpunkt erledigt werden muss und welche noch warten kann. (MUSS ich das jetzt tun? Muss ICH das jetzt tun? Muss ich DAS jetzt tun? Muss ich das JETZT tun? Muss ich das jetzt TUN?)
- Strukturen tun gut: Wenn man Alltägliches zu einem festen Ablauf macht, braucht man darauf keine Gedanken zu verschwenden. Sei es ein Essenplan für eine oder gleich zwei Wochen oder auch ein fester Badetag für die Kinder: Alles, das man geistig aus der Planungsliste streichen kann, sorgt für Linderung im "Mental Load" (Geistige Liste der Aufgaben)
- Aufgaben teilen: Beziehen Sie die Kinder mit in die Hausarbeit ein und verteilen Sie feste Aufgaben in einem Wochenplan. Der Fokus sollte hierbei auch auf dem guten Gefühl der Erledigung liegen: "Viele Hände - schnelles Ende". Auch kleine Kinder erfahren ein gutes Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn man ihnen eine Aufgabe zutraut.
- Hilfe suchen: Auch wenn es im Moment nicht einfach ist - durch die Kontaktbeschränkungen und Hygieneauflagen. Aber sich zu vernetzen, zu sprechen und Hilfen anzunehmen ist sehr wichtig. Therapeutische Hilfe vor Ort oder online, virtuelle Gesprächsgruppen oder sowie fachkundige Telefonate können sehr gut unterstützen.
Informationen der Bundesregierung zu Hilfsangeboten bei häuslicher Gewalt:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/partnerschaftsgewalt-1809976
Mein Angebot:
Bei bestehenden psychischen Beschwerden können Sie mich gerne kontaktieren.
In einem ersten Telefonat schauen wir gemeinsam, was Ihnen gut tun könnte. Da derzeit vor Ort nur therapeutische Gespräche aber keine Beratung (für Personen ohne psychische Diagnosen) erlaubt sind, ist Beratung nur via Videokonferenz ("Zoom") möglich.